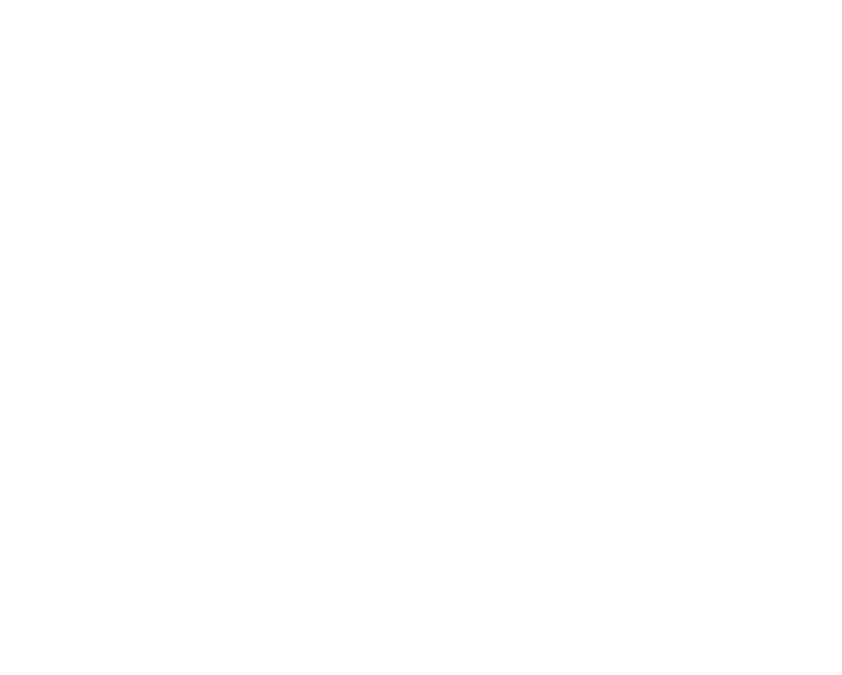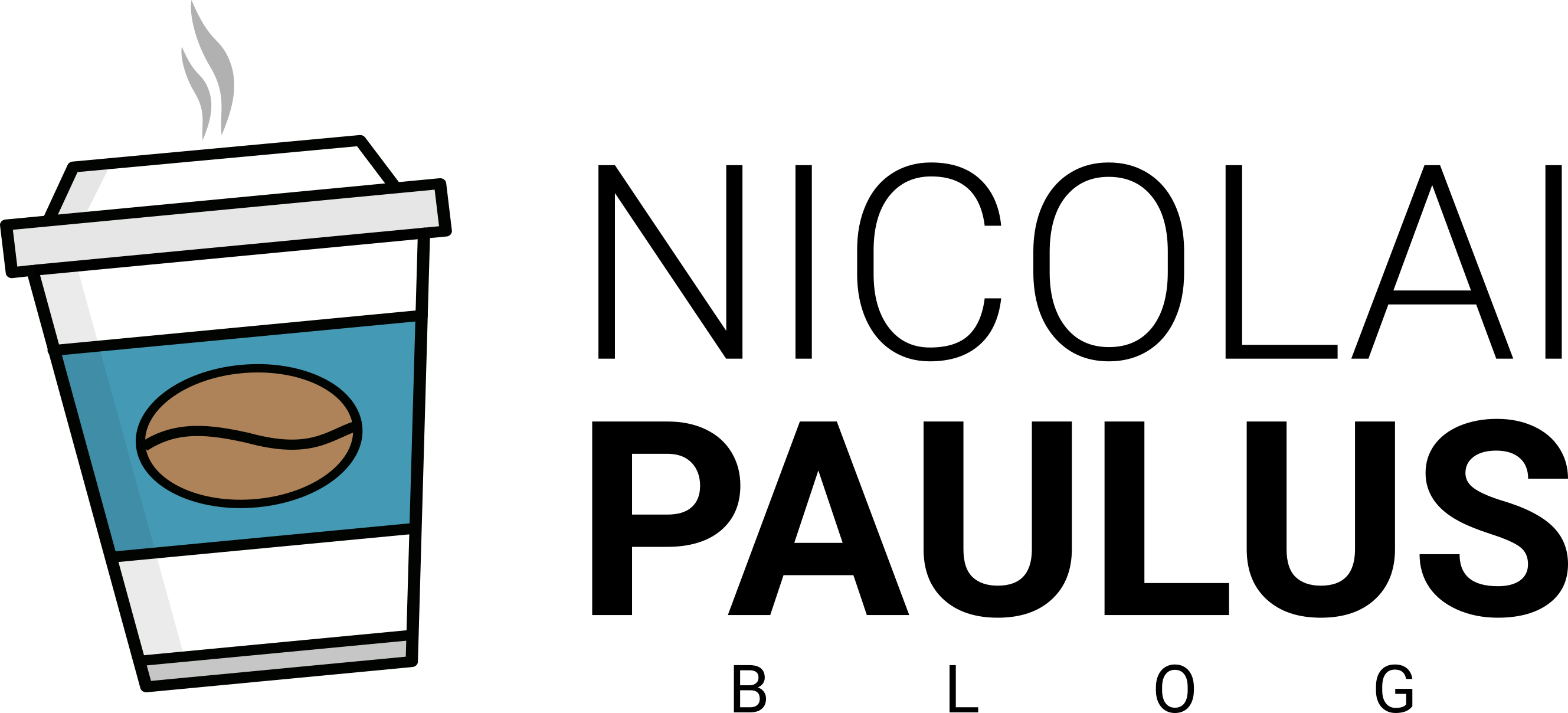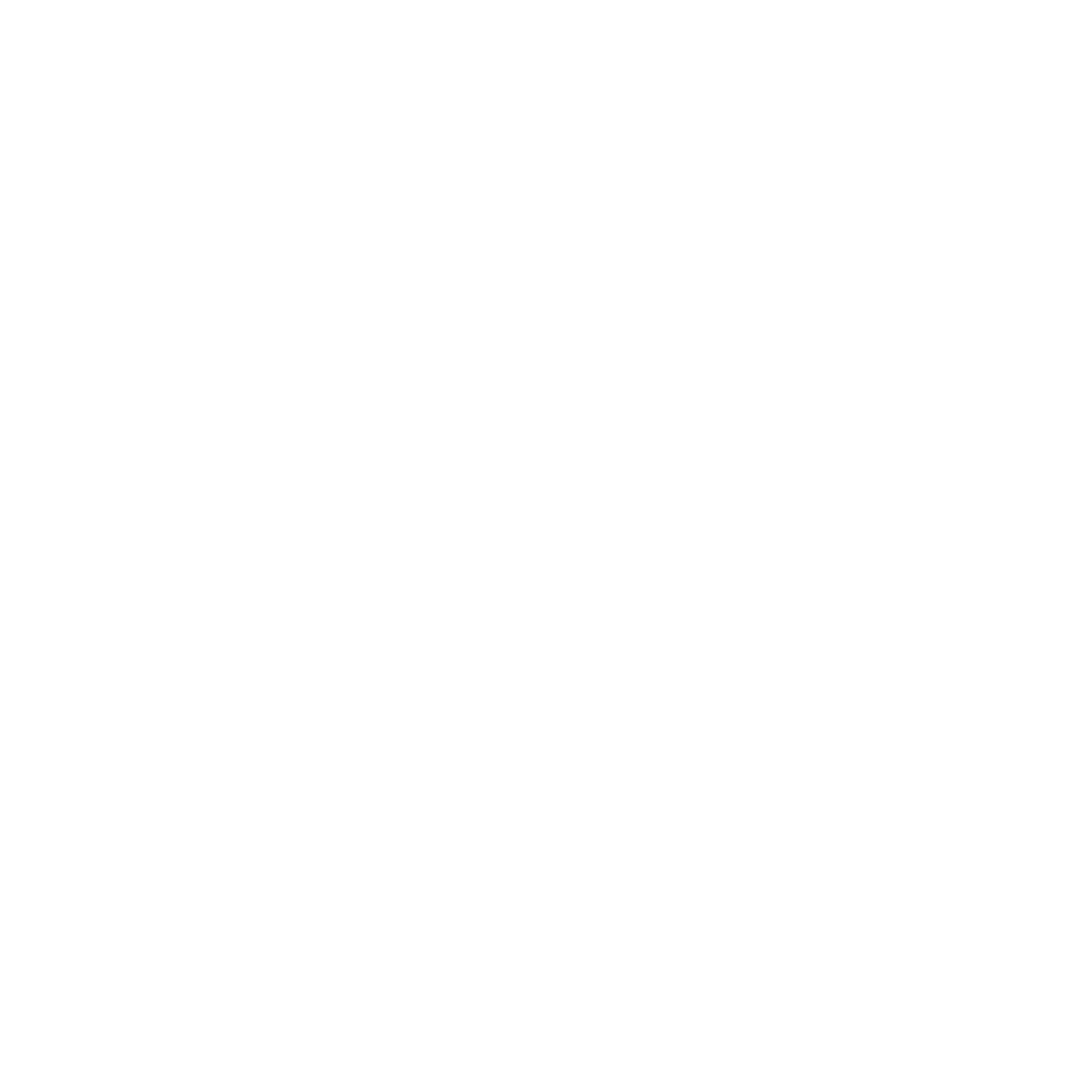Nun, auch ich komme nicht drum herum, einen kleinen Beitrag zum Thema des Jahres zu verfassen und meinen Senf dazuzugeben. Die klassischen Schlagzeilen eröffnen das Thema meist mit folgenden Argumenten: KI erobert den Klassenraum, die Schule ist mit ihren bisherigen Methoden am Ende, Lehrer sind womöglich auch weitestgehend überholt, da selbst sie nicht alle Fragen beantworten und nicht so gut erklären können. So wird auch die Sinnfrage von Schule eröffnet, wenn sich die SuS ihre Hausaufgaben mit einem Chatbot wie ChatGPT selbst mit einem Knopfdruck erstellen lassen können.
Erlaubt man das Tool bei Hausarbeiten und Ausarbeitungen, lässt sich über einen Plagiats-Check nicht feststellen, ob es wirklich die eigenen Gedanken waren, oder einfach nur Text zusammenkopiert und umformuliert wurde (Rudolph et al., 2023). Gehen die SuS noch einen Schritt weiter und erstellen sich mit einer kleinen Bastelei eine Maschine, welche den Füller führt und eine handschriftliche Ausarbeitung ermöglicht, sind Lehrende vollkommen hinters Licht geführt und können nichts mehr beanstanden. Das ist tatsächlich machbar, was in einigen YouTube-Videos bereits eindrücklich demonstriert wurde. Fasst man Schule als ein Spiel von SuS gegen Lehrer auf (was man definitiv nicht tun sollte), so steht fest: Der faule Schüler gewinnt dieses Spiel mit einem klaren Kantersieg. Sind wir ehrlich, ein bisschen hat er oder sie es sich dann aber auch verdient!
Die Ausarbeitung landet anschließend auf dem Schreibtisch des Lehrers. Ist die Lehrkraft clever, verwendet sie zur Korrektur natürlich eine KI, um den Text zu bewerten. Dieses Feedback erreicht dann den Schüler. Der Ring und die Ironie ist komplett. In Summe wurden lediglich ein paar Knöpfe gedrückt und niemand hat etwas dabei gelernt.
Beim dieser drohenden Gefahr, sollte natürlich schnell etwas unternommen werden. Was wird also eine folgerichtige, erste Entscheidung sein, die Schulen treffen? Sie verbieten den Einsatz von Chatbots und KI im schulischen Umfeld, bei Hausaufgaben ebenso wie bei Arbeiten oder Projekten. Klingt nachvollziehbar und logisch. Das Problem ist dadurch beseitigt und die klassischen Lernstandserhebungen, bei denen SuS Dinge auswendig lernen und händisch auf ein Blatt schreiben, haben noch immer ihre Berechtigung. Was ist aber die Folge daraus? SchülerInnen haben nachvollziehbar keine Lust mehr auf diese Art von Prüfungen. Wo ist denn auch die wirkliche Motivation dahinter, wenn eine KI das gleiche kann und es stellenweise sogar noch besser macht? Wieso soll ich das als SuS denn dann nicht nutzen dürfen? Die Motivation, sich aufzuraffen ist daher dann meist die gleiche: gute Noten und damit ein guter Schulabschluss, namentlich Abitur. Schulzeit überleben und das Maximale an guten Leistungsziffern dabei herausholen. Lernen steht dabei nicht unbedingt im Fokus und die Institution Schule verliert enorm an Glaubwürdigkeit und Bedeutsamkeit.
Zugegeben, das ist ein sehr düster gezeichnetes Bild. Ich denke jedoch, dass es auf ein Großteil der AbiturientInnen aktuell zutreffen könnte. Zuerst einmal liegt jeder grundlegend falsch, der in KI das Ende von Schule sieht. Schule ist ein komplexes Zusammenspiel und geht weit über das Erklären von Begriffen und Dingen hinaus. Dort werden soziale Kompetenzen neben der reinen Akkumulation von Wissen erlangt, Haltungen und Werte entwickelt und ausgeprägt. Soziales Lernen untereinander ist nicht zu vernachlässigen. Gemeinsames Lernen dient mit sozialer Eingebundenheit und Kompetenzerleben zur Steigerung der Motivation der Lernenden (siehe Deci & Ryan (1993)). Damit zu erwerbende, grundlegende Future Skills wie Kommunikation und Kollaboration sind für den zukünftigen, KI dominierten Arbeitsmarkt essentiell.
Es wird folglich darüber nachgedacht, welche Rolle die KI in der Schule spielen könnte. Betrachten wir den bisherigen, sich abzeichnenden Paradigmenwechsel in der Schule, welcher in Gestalt von Wikipedia, Google und dem Web 2.0 daherkam und sich letztendlich im Trend der Digitalisierung und der freien Verfügbarkeit von Wissen veräußerte. In diesem lassen sich auch zahlreiche Ideen für den Einsatz von ChatGPT und anderen KI finden. Wie eingangs erwähnt stellt die KI lediglich die bisherigen Methoden vor eine Hürde. Ändert man also die methodischen Werkzeuge sowie die zugrundeliegenden Pädagogik, so eröffnet die KI einige Chancen für die Schule der Zukunft. Beginnen könnte man mit dem augenscheinlich größten Problem von klassischen Lernstandserhebungen in Form von Arbeiten, Essays und zuhause erstellten Präsentationen.
Gerade ChatGPT bietet hier viele Möglichkeiten an, wie in der Oberstufe Lernen ermöglicht werden kann und eröffnet neue Formen der Leistungsbeurteilung. So empfehlen beispielsweise Rudolph et al (2023) in ihrem Literaturpaper verschiedene, vielfältige Möglichkeiten:
- Analyse von Videos, Bildern oder Quellen
- Nutzung der KI in einem Flipped Classroom
- Analyse von Texten, welche in einer Klassendiskussion oder Anwendungssituation münden
- Schreiben und Interpretieren von Geschehnissen, welche nach September 2021 (Redaktionsschluss des Trainings von ChatGPT) liegen
- Integrieren von verschiedenen Quellen und Entwerfen von eigenen Argumenten
- Arbeit mit Quellen und Liefern von Quellenkritik
Ferner können spezielle Assessments noch händisch im Klassenraum unter Ausschluss der KI durchgeführt werden. Dies empfiehlt sich zum Beispiel bei deklarativem Wissen, also wenn grundlegende Begriffe abgefragt werden. In Zukunft könnte der Fokus aber auf Präsentationen oder dem Erstellen von Webpages, Videos, Animationen oder Podcasts liegen. Es ist in diesem Setting ebenfalls nur gewinnbringend, den SuS zu erlauben, sich über ein selbst gewähltes Thema tiefer zu informieren. Dies trifft die Interessen der SuS, motiviert und fordert eigene Stimmen und Haltungen ein. Auch heben authentische Assessments durch eine bedeutsame und intrinsisch motivierende Art die Erstellung von "Leistungen" zur Beurteilung auf ein neues Level. Mit Online-Assessments kann durch Anpassung der Fragen je nach Antwort des Lernenden ein deutlich diagnostisch ausgeklügelteres Bild ermöglicht werden. Auch kann SuS mehr und adaptivere Unterstützung geboten werden (Stichwort: Learning Analytics).
Die KI kann ebenso SuS unterstützen und ein Partner im Lernprozess sein. So ist es für SuS möglich, die KI zu nutzen, um individuelle Fragen stellen zu können und weitestgehend passgenaue, detaillierte Erklärungen zu verschiedenen Themengebieten zu erhalten. Dies bietet eine super Differenzierungsmöglichkeit, da die Lehrperson eine derart individuelle Unterstützung meist nicht leisten kann. Ebenso kann die KI Echtzeitfeedback ermöglichen und den SuS sofort formatives Feedback zu Inhalten, Sprach- und Schreibstil geben.
Bei der Ausgestaltung von neuen Lernarrangements sollten stets Ziele im Vordergrund stehen, welche eine KI unbedingt nicht erreichen kann und das Reproduzieren von Wissen weit übersteigen - sogenanntes higher-order-thinking oder sogenannte higher-order-tasks (nach Levy & Murnane, 2013). Sie finden sich unter anderem in einer Kritikfähigkeit, in originellem Schreiben und kreativen Arbeiten. Sie finden sich ebenso in einer schlüssigen Argumentation und der Begründung des eigenen Standpunktes. Sie finden sich in einer Demokratisierung und Politisierung. Sie finden sich im Arbeiten in Teams an großen Vorhaben und Projekten sowie im Ausbilden von zwischenmenschlichen Fähigkeiten. Ebenso aber auch im Erlangen von Durchhaltevermögen, einer Anpassungsfähigkeit und zuguter letzt im Ausbilden einer achtsamen, selbstregulierten Persönlchkeiten. Und das klingt doch stark nach Komptetenzen, die in Zukunft notwendig sind und welche die Schule aus Bildungsinstitution gegenüber jeglicher KI auszeichnen könnte.